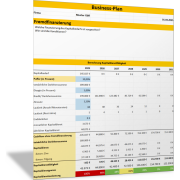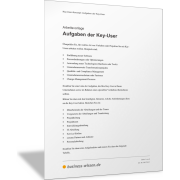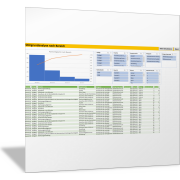Lohn und GehaltEU-Richtlinie zur Entgelttransparenz und ihre Auswirkungen
Spätestens bis zum 7. Juni 2026 wird ein neues, sehr weitreichendes Entgelttransparenzgesetz verabschiedet sein. Dieses hat umfangreiche Einflüsse auf die Ausgestaltung von Vergütungssystemen für Unternehmen aller Größenordnungen.
Auch wenn das Gesetz noch nicht vorliegt, sind bereits heute die Mindeststandards der EU-Entgelttransparenzrichtlinie zu erkennen. Hieraus ist absehbar: Die Karten im Bereich Lohn- und Gehaltsgestaltung werden vollkommen neu gemischt, der Handlungsbedarf ist hoch.
Das Gender Pay Gap: ein EU-weites und hartnäckiges Problem
Die EU mahnt schon seit Langem die Unternehmen der Gemeinschaft, Männer und Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit gleich zu vergüten. Alle Appelle nutzten bislang jedoch wenig.
Auch heute noch verzeichnen wir in Deutschland eine unbereinigte Entgeltlücke von 16 Prozent zwischen den Geschlechtern. Zu viel, nicht nur in den Augen der Gemeinschaft.
In Deutschland halfen Rechtsgrundlagen wie der Artikel 3 des Grundgesetzes (GG), das AGG sowie das EntgTranspG aus dem Jahre 2017 nicht, die Entgeltlücke zu schließen.
Dies ist aber auch wenig verwunderlich. Selbst das speziell auf diese Problematik ausgerichtete EntgTranspG ist ein Tiger ohne Zähne: Im Fokus stehen hier nur größere Unternehmen. Zudem liegt die Beweispflicht bei den Mitarbeitenden.
Warum die EU-Entgelttransparenzrichtlinie jetzt relevant ist
Die Richtlinie (EU 2023/970), am 6. Juni 2023 verabschiedet, soll hier nun die handwerklichen Defizite der Vergangenheit beseitigen. Eine Kommission des für Gleichstellung zuständigen Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend arbeitet bereits an Vorschlägen, um den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ wirkungsvoll umzusetzen.
Wichtig ist zu wissen, dass das Gesetz Auswirkungen haben wird auf Unternehmen aller Größenordnungen. Bereits ab zwei Beschäftigten müssen Firmen ein Vergütungssystem etablieren, das diskriminierungsfreie und transparente Strukturen aufweist.
Im Mittelpunkt stehen Offenheit und Transparenz, nicht nur gegenüber den Mitarbeitenden, sondern auch gegenüber den sich beim Unternehmen Bewerbenden. Beschäftigte sollen nachvollziehen können, wie ihr Lohn zustande kommt. Arbeitgeber müssen dies nachweisen und sollen bei Verstoß wirkungsvoll zur Kasse gebeten werden.
Die Beweispflicht wird somit komplett umgekehrt und auf die Unternehmen verlagert.
Erweiterte Auskunftsrechte für Beschäftigte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten ein deutlich erweitertes Auskunftsrecht – unabhängig von der Unternehmensgröße.
Sie können künftig Informationen zu ihrem eigenen Lohn und den Durchschnittsentgelten vergleichbarer Positionen des anderen Geschlechts verlangen. Diese Auskunft muss innerhalb von zwei Monaten erfolgen.
Gleichzeitig sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Beschäftigten jährlich über dieses Recht unmissverständlich zu informieren.
Darüber hinaus gilt, dass vertragliche Gehaltsverschwiegenheitsklauseln, die das Reden über das eigene Gehalt untersagen, künftig unzulässig sind.
Berichtspflichten nach Unternehmensgröße
Neu ist ein stufenweises Berichtssystem über die Entgeltstrukturen, das deutlich früher beginnt als bisher. Erstmals sind bereits Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten betroffen.
Die Abstufung bewirkt eine Berichtspflicht von Unternehmen
- ab 250 Beschäftigten bis Juni 2027 jährlich,
- ab 150 Beschäftigten bis Juni 2027 alle drei Jahre, und
- ab 100 Beschäftigten bis Juni 2031 alle drei Jahre.
Die Berichtspflicht erstreckt sich auf den Nachweis des unternehmensinternen Gender Pay Gap sowie auf die Nennung der Entgeltkriterien. Unternehmen, deren Berichte ein unerklärtes Lohngefälle ab 5 Prozent ergeben, müssen innerhalb von sechs Monaten eine gemeinsame Entgeltbewertung mit der Arbeitnehmervertretung durchführen.
In der Praxis zeigt sich, dass Abweichungen von mehr als 5 Prozent die Regel sind und somit der Anteil derjenigen Unternehmen, bei denen ein Anpassungsbedarf besteht, erheblich ist.
Vorgaben zur Gestaltung von Vergütungssystemen
Im Gegensatz zum vergleichsweise unverbindlich formulierten EntgTranspG von 2017 ist nun die Ausgestaltung der Vergütungen zumindest auf diese Anforderungen aufzubauen:
- Bildung
- Kompetenzen
- Belastung
- Verantwortung
- Arbeitsbedingungen
Im Bereich der Kompetenzen hebt die EU-Richtlinie soziale Kompetenzen ganz besonders hervor.
Sanktionen und Durchsetzung
Die Richtlinie sieht wirkungsvolle Sanktionen bei Verstößen vor: Unternehmen drohen
- Schadensersatzansprüche,
- Bußgelder und
- gegebenenfalls der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen.
Beschäftigte und Gewerkschaften erhalten zudem das Recht, über Sammelklagen Diskriminierungen gerichtlich prüfen zu lassen.
Somit ist erkennbar, dass die rechtlichen Auswirkungen der neuen Gesetzeslage juristische Folgewirkungen haben werden, die mit denen der Datenschutzgrundverordnung zu vergleichen sind.
Neue Transparenzpflichten im Bewerbungsprozess
Bereits im Recruiting müssen künftig Einstiegsgehälter oder Gehaltsspannen offengelegt werden – etwa in Stellenanzeigen (was jedoch nicht verpflichtend ist) oder spätestens vor dem Vorstellungsgespräch.
Zudem dürfen Arbeitgeber keine Fragen mehr zur Gehaltshistorie der Bewerbenden stellen. Diese neue Regelung betrifft ausdrücklich auch kleine Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten und verändert damit die bisherige Praxis vieler KMU wesentlich.
Was auch kleine Unternehmen jetzt tun sollten
Auch wenn Betriebe mit weniger als 100 Mitarbeitenden zunächst keine Pflichtberichte erstellen müssen, sollten sie sich frühzeitig auf die neuen Standards vorbereiten. Empfehlenswert sind:
- Idealerweise eine EDV-basierte Überprüfung der Gehaltsstrukturen auf Geschlechtergerechtigkeit, idealerweise aufbauend auf einem System von Stellenbeschreibungen
- Einführung objektiver Bewertungskriterien für Tätigkeiten, passend zu den Unternehmensanforderungen
- Klare Kommunikation im Recruiting
- Anpassung von Arbeitsverträgen und internen Richtlinien
- Sensibilisierung der Führungskräfte und Personalverantwortlichen
Diese Maßnahmen stärken nicht nur die Compliance, sondern auch das Employer Branding.
Bewerbende erwarten zunehmend transparente Vergütungsmodelle – unabhängig von rechtlichen Vorgaben.
Daher sollte die Kehrtwende nicht einseitig als Muss, sondern als Chance verstanden werden. Einen Vergütungswildwuchs der Vergangenheit mit teilweise bis zu erpresserischen Gehaltsverhandlungen wird es in der Zukunft nicht mehr geben.
Fazit
Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie markiert einen Paradigmenwechsel: Gehaltstransparenz wird zur gesetzlichen Pflicht und zu einem Wettbewerbsfaktor. Für kleinere Unternehmen eröffnet sie zugleich die Chance, faire und nachvollziehbare Strukturen zu etablieren – bevor Prüfpflichten strenger werden.
Wer früh handelt, kann die neuen Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern sie aktiv für eine attraktive und gerechte Unternehmenskultur nutzen.