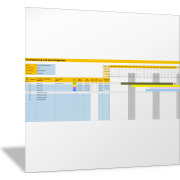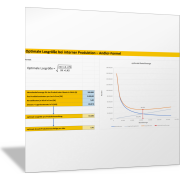KI-AkzeptanzMenschlichkeit als Schlüsselfaktor für den KI-Einsatz
Drei häufige Fehlerquellen in KI-Projekten
Falsche Prioritätensetzung bei Investitionen
Ein Fehler bei der Einführung und Nutzung von KI-Technologien besteht darin, dass Unternehmen ihre Budgets in die falschen Bereiche lenken. Oft fließen erhebliche Mittel in Marketing-Tools, bei denen der Return on Investment (ROI) vergleichsweise niedrig ausfällt.
Stattdessen wären Investitionen in die Effizienzsteigerung interner Prozesse, wie sie im Backoffice stattfinden, weitaus lohnender. Bereiche wie das Controlling oder administrative Abläufe bieten erhebliches Potenzial für Optimierungen, die direkt zur Kostensenkung und Produktivitätssteigerung beitragen.
Die „Bauen statt Kaufen“-Falle
Viele Firmen neigen dazu, in teure und ressourcenintensive In-House-Projekte zur Entwicklung eigener Softwarelösungen zu investieren. Studien und Erfahrungen zeigen jedoch, dass der Zukauf von externen, bereits am Markt bewährten Lösungen in der Regel doppelt so erfolgreich ist wie Eigenentwicklungen.
Externe Tools sind oft schneller implementiert, kostengünstiger im Unterhalt und technologisch ausgereifter, da sie von spezialisierten Anbietern entwickelt und kontinuierlich optimiert werden.
Hemmnis durch Zentralisierung
Ein weiterer kritischer Punkt ist die organisatorische Verankerung von Innovationsprojekten. Projekte, die dezentral und direkt in den jeweiligen Fachabteilungen angesiedelt sind, weisen eine höhere Erfolgsquote auf.
Der Grund dafür ist, dass die Teams vor Ort das nötige Fachwissen besitzen und die entwickelten Lösungen unmittelbar an ihren praktischen Bedürfnissen ausrichten können.
Im Gegensatz dazu scheitern zentralisierte, prestigeträchtige „AI-Labs“ oder Innovationsabteilungen häufiger, da ihnen die Nähe zum operativen Geschäft fehlt und ihre Projekte nicht immer den tatsächlichen Bedarf treffen.
Parallelen zur PC-Ära: Prozesse neu denken
Die Schwierigkeiten sind nicht neu. Schon in den 1980er-Jahren beobachtete Robert Solow das „Paradox der Computerproduktivität“: Überall zogen PCs ein, doch in den Produktivitätsstatistiken war davon lange nichts zu sehen.
Erst Jahre später machten sich die Effekte bemerkbar, nachdem Unternehmen ihre Prozesse, ihre Strukturen und ihre Kultur angepasst hatten. Niemand würde heute den PC infrage stellen. Aber der Weg dorthin war ein Kraftakt.
Mit generativer KI stehen Unternehmen an einem ähnlichen Wendepunkt. Der Unterschied: Diesmal ist die Technologie probabilistisch. Sie liefert Ergebnisse, die „meistens richtig“ sind – aber nicht immer.
Das zwingt Unternehmen, Arbeitsprozesse neu zu denken, Fehlertoleranzen einzubauen und Mitarbeitende stärker in die Kontrolle über die Maschine einzubinden.
Menschlichkeit als Erfolgsfaktor beim KI-Einsatz
KI unterstützt, führt aber nicht. Für Führungskräfte gilt: Weniger KI kann mehr sein.
Lernen Sie zu unterscheiden, was die Maschine besser kann (zum Beispiel viele Daten von A nach B verschieben) und was der Mensch besser kann:
- Netzwerken
- Beziehungen aufbauen
- Begeisterung wecken
- gelebte Expertise einbringen
Nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden in jedem Schritt mit. Beginnen Sie nicht damit, großartige KI-Strategien zu entwickeln und Ihre Teams Top-down damit zu beglücken.
Unternehmen und Verbände sollten immer klein beginnen: In ein Team gehen und dort eine Aufgabe mithilfe von Künstlicher Intelligenz oder einer Automatisierung lösen. Ganz konkret, Schritt für Schritt.
Eine „low hanging fruit“ schafft Akzeptanz für weitere KI-Anwendungen, weil der Mehrwert für alle Mitarbeitenden ersichtlich ist. Künstliche Intelligenz ist nicht mehr abstrakte Theorie, sondern Praxis, welche die Arbeit erleichtert.
Tipps für Führung und Teams
Was das für Sie bedeutet:
Fokus auf den spürbaren Nutzen legen
Setzen Sie Künstliche Intelligenz gezielt dort ein, wo sie Ihnen einen unmittelbaren und messbaren Vorteil verschafft. Anstatt abstrakten Zielen zu folgen, konzentrieren Sie sich auf konkrete Verbesserungen in Geschwindigkeit oder Qualität.
Besonders großes Potenzial liegt in Bereichen wie
- der Datenanalyse, wo KI in Sekunden riesige Datenmengen auswerten kann,
- im Kundensupport durch die Automatisierung von Standardanfragen oder
- in der Buchhaltung und Administration, wo Routineaufgaben effizienter gestaltet werden können.
Den Menschen im Mittelpunkt behalten
Trotz aller technologischen Möglichkeiten bleiben die wahren Wachstumstreiber Ihres Unternehmens menschlich. Unternehmergeist, echte Kundennähe, strategische Weitsicht und eine starke Teamkultur sind Qualitäten, die eine KI nicht ersetzen kann.
Sehen Sie KI als ein unterstützendes Werkzeug, das Freiräume für diese Kernkompetenzen schafft, aber überlassen Sie ihr nicht die Führung. Die wichtigsten Entscheidungen und die Gestaltung der Unternehmenskultur müssen in menschlicher Hand bleiben.
Mitarbeitende befähigen und einbinden
Die erfolgreiche Einführung von KI hängt entscheidend von der Akzeptanz Ihrer Teams ab.
Wer seine Mitarbeitenden frühzeitig in den Prozess einbindet, kann Ängste vor dem Arbeitsplatzverlust abbauen und stattdessen Neugier und Offenheit fördern. So wird KI nicht als Bedrohung, sondern als nützliches Werkzeug wahrgenommen.
Investitionen in Schulungen und Weiterbildungen zahlen sich hier doppelt aus: Sie steigern nicht nur die Produktivität durch den kompetenten Umgang mit den neuen Technologien, sondern fördern auch die Loyalität und das Engagement Ihrer Mitarbeitenden.
Menschliche Stärken gezielt nutzen
In einer zunehmend automatisierten und synthetischen Welt werden menschliche Fähigkeiten noch wertvoller. Kompetenzen wie Empathie im Umgang mit Kunden und Kollegen, Kreativität bei der Lösung komplexer Probleme, der Aufbau von tragfähigen Beziehungen und unternehmerisches Denken werden zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren.
Künstliche Intelligenz kann in diesen Bereichen lediglich eine ergänzende Rolle spielen, indem sie beispielsweise Daten liefert oder Prozesse vereinfacht. Die eigentliche Stärke entsteht jedoch erst durch die menschliche Anwendung dieser Fähigkeiten.
Praxisbeispiele: KI als Werkzeug für den Menschen
Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung
Ein mittelständischer Hersteller von Steuergeräten stand vor der Herausforderung, die manuelle Prüfung von Lötstellen zu optimieren. Durch die Einführung einer KI-gestützten Bildanalyse konnte dieser Prozess automatisiert werden, was die Fehlererkennung deutlich beschleunigte und präzisierte.
Der entscheidende Erfolgsfaktor war jedoch nicht die Technologie allein, sondern die Einbindung der Mitarbeitenden: Die Fachkräfte am Fließband wurden von Anfang an darin geschult, die Ergebnisse der KI zu interpretieren, zu validieren und auf Basis der Analysen eigene Verbesserungsvorschläge einzubringen.
Statt Verunsicherung zu schaffen, führte dieser Ansatz zu echter Befähigung. Das Ergebnis: eine höhere Effizienz und eine gestärkte Rolle der Mitarbeitenden als Experten für den Gesamtprozess.
Recruiting und Personalwesen (HR)
Ein HR-Team nutzt generative KI, um den Bewerbungsprozess effizienter zu gestalten. Lebensläufe werden automatisch analysiert und relevante Informationen für die Personalverantwortlichen vorstrukturiert. Zudem generiert die KI erste Entwürfe für Interviewleitfäden.
Statt das Team durch Technologie zu ersetzen, investierte das Unternehmen gezielt in die Schulung der Mitarbeitenden. Sie lernten, die von der KI gelieferten Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und als Grundlage für ihre eigene, fundierte Entscheidung zu nutzen.
Dadurch fühlten sich die Mitarbeitenden nicht nur ernst genommen, sondern entwickelten auch Vertrauen in die neue Technologie. Die gewonnene Zeit ermöglicht es ihnen, sich intensiver auf den persönlichen Austausch mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu konzentrieren.
Der Weg vorwärts: Schrittweise Integration
Generative KI ist kein Plug-and-play-Tool, sondern ein neues Betriebssystem für die Arbeitswelt.
Wer glaubt, einfach ein paar Tools einführen zu können, wird wahrscheinlich scheitern. Wer hingegen versteht, dass es um bewussten Einsatz, klare Prioritäten und menschliche Führung geht, hat große Chancen, in der Gruppe der erfolgreichen Projekte zu landen.
Denn am Ende entscheidet nicht die Anzahl der KI‑Systeme über den Erfolg – sondern die Fähigkeit, Menschen zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
KI ist dabei ein starker Hebel. Doch die Hand, die ihn bewegt, bleibt menschlich.