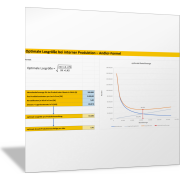OrganisationsentwicklungDen „wind of change“ für Veränderungen nutzen
Am Change- und Transformationsbedarf besteht kein Zweifel
In unserer Gesellschaft herrscht zurzeit parteien- und die verschiedenen Gesellschaftsgruppen übergreifend ein Konsens, dass sich in unserer Gesellschaft und in den Betrieben sehr vieles verändern muss, damit unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird oder dies bleibt.
Das erleichtert es Unternehmen aktuell, auch solche Change- und Transformationsprojekte in ihrer Organisation anzukündigen und zu realisieren, die
- mit einem Personalabbau verknüpft sind und
- massive Auswirkungen auf die Arbeitssituation ihrer Mitarbeitenden haben.
Risiko bei Change-Projekten
Gleichwohl müssen auch diese Projekte professionell gemanagt werden. Ansonsten droht eine Situation, die man in Unternehmen im Umbruch oft registriert: In den oberen Führungsetagen herrscht, nachdem die erforderlichen strategischen Grundentscheidungen getroffen wurden, eine Aufbruchsstimmung.
Zudem verbreiten sie – zumindest nach außen – eine große Zuversicht „Wir schaffen das, wenn …“. Auf den unteren Ebenen hingegen liegen die Nerven blank. Hier dominiert die Zukunftsangst und brodelt die Gerüchteküche darüber, was „die da oben“ vorhaben. Entsprechend negativ ist die Stimmung und Atmosphäre im Betrieb.
Die zentralen Aufgaben eines Change-Managers nach Kotter
Die zentralen und wichtigsten Aufgaben des Managements beim Initiieren und Realisieren von Change- und Transformationsvorhaben hat der Harvard-Professor John P. Kotter wie folgt beschrieben:
- Create a sense of urgency: Die Unternehmensführung muss allen Betroffenen und Beteiligten die Notwendigkeit der Veränderung aufzeigen und bewusst machen.
- Create a coalition: Sie muss sich Verbündete suchen, die sie aktiv unterstützen.
- Develop a clear vision: Sie muss eine Vision haben, wohin die Reise geht, und eine Strategie, wie die definierten Ziele erreicht werden.
- Share the vision: Die Veränderungsvision muss den Betroffenen und Beteiligten professionell kommuniziert werden.
- Empower people to clear obstacles: Die Mitarbeitenden müssen mit den nötigen Befugnissen und Kompetenzen ausgestattet werden, um im Prozess auftretende Hindernisse und Widerstände zu beseitigen.
- Secure short-term wins: Kurzfristige (Teil-)Erfolge müssen gezielt geplant und kommuniziert werden, damit bei allen Beteiligten das Vertrauen wächst: „Wir können das große Ziel erreichen“.
- Consolidate and keep moving: Das Management muss das Erreichte sichern, den Change-Prozess gezielt vorantreiben und die Change-Energie hochhalten.
- Anchor the change: Die erreichten Veränderungen müssen in der Organisation verankert und in die Unternehmenskultur integriert werden.
Ziele und Rahmenbedingungen für die Change- und Transformationspraxis
Change-Projekte in Unternehmen werden oft vor dem Hintergrund der folgenden Ziele und Rahmenbedingungen durchgeführt:
- Das Projekt soll von den Mitarbeitenden mitgetragen werden.
- Ihr Engagement soll im Projektverlauf hoch bleiben.
- Die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen trotz des Personalabbaus für sich eine Perspektive im Unternehmen sehen.
- Die Mitarbeitenden, denen gekündigt werden soll, sollen beim Entwickeln einer neuen beruflichen Perspektive unterstützt werden – auch um zu vermeiden, dass die Identifikation der sogenannten „Survivor“, also der verbleibenden Mitarbeitenden, mit ihrem Arbeitgeber sinkt und das Image des Unternehmens (als Arbeitgeber) Schaden erleidet.
Die Vorgehensbeschreibung von Kotter bleibt recht vage, da sie von der Situation in den einzelnen Unternehmen und in den verschiedenen Branchen abstrahiert.
Deshalb kommen im Folgenden noch einige Tipps, worauf Unternehmen beim Realisieren eines Change-Projekts achten sollten – sofern ihnen die genannten Ziele und Rahmenbedingungen wichtig sind.
Ein detailliertes Drehbuch verfassen
Das Erreichen dieser Ziele erfordert ein detailliertes Drehbuch für den Changeprozess. Dieses sollte auch ein Kommunikationskonzept enthalten, in dem definiert ist, wann wer welche Informationen durch wen über den geplanten Veränderungsprozess erhält.
Um ein Brodeln der Gerüchteküche und unnötige Unruhe in der Organisation zu vermeiden, sollte zudem so früh wie möglich publik gemacht werden, welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt wird. Dies ist nötig, um
- den verbleibenden Mitarbeitenden die Gewissheit zu vermitteln, „Euer Job ist sicher“ und
- den Mitarbeitenden, die entlassen werden, die Möglichkeit zu bieten, sich frühzeitig nach einer neuen beruflichen Perspektive umzuschauen.
Führungskräfte unterstützen
Aus Change-Projekten resultieren stets auch besondere Anforderungen an die Führungskräfte. Deshalb sollten für sie Unterstützungsmaßnahmen organisiert werden – zum Beispiel Schulungen zu Themen wie „Führen in Zeiten von Personalabbau“ und „Führen von Trennungsgesprächen“.
Zudem empfiehlt es sich, den Führungskräften einen Coach zur Seite zu stellen, den sie im Bedarfsfall kontaktieren können. Denn mit jedem Change-Prozess geht nicht nur eine höhere Arbeitsbelastung, sondern auch eine höhere psychische Belastung einher.
Ein begleitendes Coaching ist auch nötig, weil sich größere Changeprozesse nur bedingt zentral steuern lassen. Deshalb benötigen die lokalen Einheiten eine fachliche und mentale Unterstützung.
Frühwarnsysteme installieren
Sinnvoll ist es zudem, in der Organisation ein „Frühwarnsystem“ zu implementieren. Das soll im Projektverlauf zeigen, ob das Unternehmen sich noch auf dem richtigen Weg befindet und
- die Projektziele erreicht werden oder
- ein Interventionsbedarf besteht.
Zudem sollte eine Art Seismograf existieren, der anzeigt, inwieweit die Mitarbeitenden noch hinter dem Projekt stehen. Denn: In Veränderungsprozessen sinkt im Projektverlauf zuweilen die Motivation von Betroffenen, obwohl sie dem Prozess eigentlich positiv gegenüberstehen.
So zum Beispiel, wenn sie allmählich merken, was die geplante Veränderung für sie bedeutet. Oder wenn unvorhergesehene Probleme auftauchen.
Deshalb sollte das Frühwarnsystem melden, wenn bei bestimmten Mitarbeitergruppen die Gefahr besteht, dass sie aus dem Prozess aussteigen. Dies kann zum Beispiel eine regelmäßig stattfindende (partielle) Mitarbeiterbefragung – differenziert nach Hierarchieebenen – sein, die die Dimensionen „Information“, „Kommunikation“, „Engagement“ und „Unterstützung“ umfasst.
Die gekündigten Mitarbeitenden fair behandeln
Der Gefahr, dass gekündigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Prozess stören, kann mit einem „Exit-Programm“ entgegengewirkt werden. Das regelt,
- wie der Kündigungs- und Trennungsprozess gestaltet wird und
- welche Unterstützung die Gekündigten beim Verarbeiten der Kündigung sowie beim Entwickeln einer neuen Perspektive erhalten.
Dies ist nötig, damit die gekündigten Mitarbeitenden nach einem anfänglichen Frust registrieren: Das Unternehmen fühlt sich uns – trotz Kündigung – weiterhin verpflichtet, sodass
- der Krankenstand nicht „explodiert“ und
- die Zahl der Arbeitsgerichtsprozesse überschaubar bleibt.
Die Existenz eines solchen Programms ist aber auch für das Befinden der „Survivor“, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen das Unternehmen seine Zukunft gestalten möchte, wichtig.
Denn: Inwieweit sie ihrem Arbeitgeber noch vertrauen, hängt auch davon ab, wie fair sie dessen Umgang mit ihren Ex- oder Noch-Kollegen empfinden.
Beachten Unternehmen die genannten Punkte, dann können sie auch Change- und Transformationsprojekte weitgehend störungsfrei realisieren, die
- mit einem Personalabbau verbunden sind oder
- für die (verbleibenden) Mitarbeitenden tiefe Einschnitte bedeuten.
Change- und Transformationsprojekte jetzt starten
Dies gilt insbesondere in einer Situation, in der gesellschaftlich weitgehend ein Konsens besteht:
- Die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen und unternehmerischen Handelns haben sich fundamental gewandelt und werden sich auch weiterhin massiv verändern; zum Beispiel durch KI, Klimawandel oder politische Verwerfungen.
- In sehr vielen Unternehmen – nahezu branchenübergreifend – existiert ein hoher Changebedarf, wenn sie auch künftig erfolgreich sein möchten.
Denn in ihr können Unternehmen ihren Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern recht einfach vermitteln: „Wir müssen aktiv werden, damit wir …“ – und zwar ohne, dass sogleich (firmenintern und -extern) das Management am Pranger steht.
Entsprechend problem- und widerstandslos lassen sich Change- und Transformationsprojekte initiieren und realisieren – wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
- Das Unternehmen plant das Change-Projekt professionell.
- Es spielt soweit möglich mit offenen Karten.
- Und es integriert die Mitarbeitenden in den Prozess.