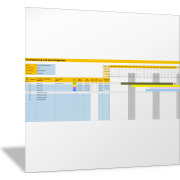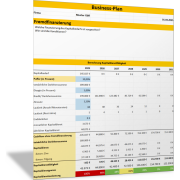AGGWas tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
Ungleichbehandlung ist am Arbeitsplatz schon lange verboten. Dazu zählt auch sexuelle Belästigung, die als Benachteiligung auf Basis des Geschlechts einzuordnen ist. Das Verbot galt zuerst durch das Beschäftigtenschutzgesetz und ist seit 2006 durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) festgeschrieben.
Doch warum hat sich seitdem wenig an Betriebskulturen sowie bei den Beschwerde- und Unterstützungssystemen für Betroffene geändert?
Das AGG wird noch nicht ausreichend umgesetzt
Studien der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) zeigen, dass viele nicht wissen, wohin sie sich im Falle einer Belästigung wenden sollen. Oft gibt es auch keine Beschwerdestelle im Betrieb.
Die ADS schlussfolgert, dass weder die Bekanntmachung der Beschwerdestelle noch eine effektive Präventionsarbeit an Arbeitsplätzen in Deutschland Status quo sind.
Dieses Missverhältnis zwischen gesetzlichen Anforderungen und betrieblichen Realitäten zeigt, dass viele Betriebe der gesetzlichen Arbeitgeberfürsorgepflicht noch immer nicht nachkommen. Arbeitgebende haben gewisse Pflichten bezogen auf die Umsetzung des AGG. Beschäftigte hingegen genießen gewisse Betroffenenrechte, die Ihnen nicht verwehrt werden dürfen.
Notwendig ist ein Kulturwandel
Dynamiken wie Schuldumkehr (victim blaming), Scham, Angst und Bagatellisierung sind eng mit Fällen sexualisierter Gewalt und Belästigung verknüpft und erschweren es Betroffenen, von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Aktive Präventionsarbeit steuert dagegen.
Diese umfasst nicht nur die Einrichtung einer Beschwerdestelle und das Verfassen von Dienst- oder Betriebsvereinbarungen oder Leitlinien. Ein Kulturwandel muss aktiv (vor-)gelebt werden. Dazu gehören:
- Haltung zu zeigen, muss eine alltägliche Aufgabe für Führungskräfte sein. Zum Beispiel, wenn ein Vorgesetzter einen Kollegen darauf hinweist, dass sein Witz unangemessen war.
- Oder wenn eine Kollegin nach einem unangenehmen Erlebnis von einer Person, die den Vorfall mitbekommen hat, gefragt wird, wie es ihr geht und ob sie Unterstützung möchte.
- Auch das gilt als Hilfeleistung: ein einfaches „Ich habe das auch gehört und empfand es als unangemessen. Brauchst du etwas?”
- Kulturwandel zeigt sich auch daran, wenn in einem Meeting der einzigen Frau im Raum nicht ständig ins Wort gefallen und ihre Meinung ebenso wertgeschätzt wird wie die der männlichen Kollegen.
- Dazu zählt ebenfalls, dass es keine „blöden Sprüche“ gibt, weil ein Vater Elternzeit nehmen möchte.
Sexismus und sexuelle Belästigung sind eng miteinander verschränkt. Ein Kulturwandel setzt daher weit vor einer Grenzverletzung an.
Absicht und Wirkung des unangemessenen Verhaltens
Oft war grenzüberschreitendes Verhalten von ausübenden Personen tatsächlich nicht grenzüberschreitend gemeint. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht (nur) auf die Intention einer Aussage oder Handlung ankommt, sondern auch auf die Wirkung, die diese auf die betroffene Person hatte.
Dieses Konzept nennt sich Deutungsmacht von Betroffenen. Niemand kann für andere entscheiden, wo deren Grenzen verlaufen und was als unangenehm wahrgenommen wird oder nicht. Und es kann uns allen passieren, dass wir die Grenzen von anderen Menschen unabsichtlich überschreiten.
Die Akzeptanz darüber, dass dies auch mir selbst passieren kann, ist der erste Schritt zu einer Haltung im Sinne einer Verantwortungs- und Entschuldigungskultur.
Die Maxime dieses Konzepts liegt darin, Grenzüberschreitungen möglichst zu verhindern, aber bei einer entsprechenden Rückmeldung nicht in Mechanismen wie Leugnung oder Bagatellisierung zu verfallen; typische Beispiele dafür sind Aussagen wie: „Das war nur witzig gemeint.“ „Jetzt übertreibst du aber.“
Stattdessen gilt es, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, zum Beispiel mit dem Versuch, zu verstehen, worin das eigene problematische Verhalten bestand. Darauf folgen sollte die Bereitschaft, sich ehrlich zu entschuldigen und das grenzüberschreitende Verhalten einzustellen.
Was tun bei sexueller Belästigung?
Sollte ein konkreter Fall sexueller Belästigung auftreten, gibt es unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten.
Eine entsprechende Haltung (wie oben geschildert) ist der erste wichtige Schritt. Und obgleich jede Situation einzigartig ist, lassen sich generelle Hinweise für mögliche Handlungsoptionen formulieren.
Dabei kommt es natürlich darauf an, welche Position und Verantwortung Sie haben.
Mitarbeitende
Arbeiten Sie mit der ratsuchenden Person zusammen und haben Sie einen Vorfall mitbekommen? Dann sollte der betroffenen Person auf jeden Fall Unterstützung signalisiert werden. Oft macht dieses Angebot bereits einen großen Unterschied und reduziert die Unsicherheit, die Betroffene in der Regel empfinden.
Vielleicht kennen Sie Anlaufstellen innerhalb (oder außerhalb) Ihrer Organisation und können beim Aufsuchen dieser unterstützen.
Führungskräfte
Sind Sie eine Person mit Führungsverantwortung, ist ein konsequentes Handeln gefragt. Kommt eine ratsuchende Person auf Sie zu, dürfen Sie die Meldung nicht ignorieren, sondern müssen dem Fall nachgehen und dafür sorgen, dass bestehende Diskriminierungen beseitigt werden.
Ein transparent kommuniziertes und klar geregeltes Beschwerdeverfahren gibt allen Beteiligten Sicherheit.
Insofern eine interne Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass zum Beispiel eine sexuelle Belästigung vorliegt, sind laut AGG die „geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen“ zur Unterbindung der Benachteiligung zu ergreifen.
Arbeitgebende
Sie haben die Leitung oder Geschäftsführung inne und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine Stelle einzurichten, die Beschwerden annimmt und prüft.
Meldet sich eine Person direkt bei Ihnen, gilt für Sie das Gleiche wie für Führungskräfte.
Haben Sie sich bereits mit dem Thema Prävention beschäftigt? Auch die Umsetzung von vorbeugenden Maßnahmen trägt dazu bei, dass Sie Ihre Fürsorgepflicht erfüllen.
Eine hilfreiche Unterstützung bietet die Handreichung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?“ Diese steht auch Arbeitgebenden bei Fragen rund ums AGG beratend zur Seite.