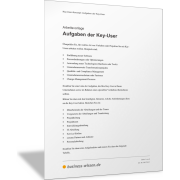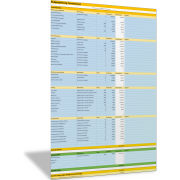FührungsfehlerEmotionale Abwesenheit von Vorgesetzten
Was bedeutet „emotionale Abwesenheit“?
Führung bedeutet, Orientierung zu geben, Entscheidungen zu treffen und Verbindung zu schaffen. Doch was auf dem Papier so klar klingt, wird im Alltag leicht überlagert: von Hektik, Termindruck, Sachzwängen und nicht zuletzt von eigenen Erwartungen an Leistung und Kontrolle.
Viele Führungsfehler entstehen nicht aus Desinteresse oder Inkompetenz, sondern aus Überforderung, Automatismus und einem häufig übersehenen blinden Fleck: der emotionalen Abwesenheit.
Gemeint ist damit nicht mangelnde Freundlichkeit oder fehlende Kommunikation, sondern das Ausbleiben echter Verbindung zu den Menschen, die geführt werden.
Die unterschätzte Gefahr emotionaler Abwesenheit
Führungskräfte, die emotional abwesend sind, erledigen Aufgaben effizient, treffen Entscheidungen und erscheinen in Meetings, aber sie sind innerlich nicht erreichbar. Sie führen Gespräche, aber keine echten Dialoge. Sie reagieren, aber reflektieren nicht.
Die Beziehungsebene bleibt leer. Die Folgen sind schleichend, aber spürbar:
- Mitarbeitende ziehen sich zurück.
- Feedback wird vage oder ganz eingestellt.
- Initiative nimmt ab.
- Reibungen nehmen zu.
- Die Führungskraft verliert unbemerkt an Wirksamkeit.
Dabei ist emotionale Präsenz kein weiches Extra, sondern ein zentraler Wirkfaktor für Motivation, Vertrauen und Eigenverantwortung im Team.
Typische Führungsfehler durch emotionale Abwesenheit
Fehlt die innere Verbindung zu sich selbst und zu anderen, greifen Führungskräfte häufig auf gut gemeinte, aber wirkungsarme Muster zurück. Diese Strategien sollen Stabilität und Struktur bringen. Doch oft entstehen sie aus unbewussten Schutzmechanismen.
Statt Vertrauen wachsen Kontrolle und Missverständnisse. Statt Dialog entsteht Rückzug. Was als Fürsorge gemeint ist, wird als Einmischung erlebt.
Die folgenden vier Muster treten besonders häufig auf, wenn emotionale Präsenz fehlt.
Mikromanagement: Kontrolle anstelle von Vertrauen
Emotionale Abwesenheit führt häufig zu einer Überidentifikation mit dem Operativen. Wer den Kontakt zur eigenen Wahrnehmung verliert, beginnt zu kontrollieren, zu korrigieren und zu übernehmen, meist aus dem Bedürfnis, Unsicherheit durch Handlung zu regulieren.
Typische Anzeichen für Mikromanagement
- Aufgaben werden übernommen, ohne dass jemand danach gefragt hat.
- Arbeitsergebnisse werden mehrfach kontrolliert – trotz hoher Qualität.
- Rückfragen werden vorweggenommen oder direkt selbst beantwortet.
- Operative Themen dominieren den Kalender – strategische Reflexion bleibt außen vor.
Typische innere Auslöser
- das Gefühl, „alles im Griff haben zu müssen“
- die Angst, dass etwas übersehen wird
- das Bedürfnis, unklare Situationen durch Handlung zu kontrollieren
Was hilft
- Verlangsamung: bewusste Übergänge zwischen Aufgaben schaffen
- Reflexion: „Bin ich gerade im Führungsmodus oder in der Fachkraftrolle?“
- Vertrauen aktiv kommunizieren: „Ich überlasse dir das, sag mir gern, wenn du Unterstützung brauchst.“
Konflikte vermeiden: Probleme bleiben unsichtbar
Führung erfordert Konfrontationsfähigkeit, nicht im Sinne von Härte, sondern im Sinne von Wahrhaftigkeit. Doch wer innerlich nicht stabil ist, erlebt Konflikte schnell als belastend und vermeidet sie. Emotionale Abwesenheit verstärkt diesen Rückzug.
Typische Verhaltensmuster
- Kritische Themen werden vertagt oder gar nicht angesprochen.
- Spannungen im Team werden ignoriert.
- Erwartete Konsequenzen bleiben aus.
- Es wird versucht, „das Gespräch in Ruhe zu führen“ – aber es findet nie statt.
Typische Denkfallen
- „Ich will das Verhältnis nicht gefährden.“
- „Das regelt sich bestimmt von selbst.“
- „Das ist jetzt nicht der richtige Moment.“
Was hilft
- kleine Konfliktsignale ernst nehmen
- innere Klarheit vor dem Gespräch schaffen
- Aussagen klar trennen: Beobachtung, Wirkung, Wunsch
Reflexionsfrage
Was spricht in mir dagegen, ein Thema klar anzusprechen? Ist es Angst, Unsicherheit oder der Wunsch nach Harmonie?
Unklare Kommunikation: Entscheidungen kommen nicht an
Führung ohne klare Kommunikation ist wie Navigation ohne Kompass. Wer innerlich nicht verankert ist, vermeidet es oft, eine Position zu beziehen. Häufig geschieht das unbewusst aus Rücksicht, Unsicherheit oder der Angst, nicht gemocht zu werden.
Typische Muster
- Entscheidungen werden angedeutet, aber nicht klar formuliert.
- Erwartungen bleiben vage oder unausgesprochen.
- Rollen und Zuständigkeiten sind nicht eindeutig benannt.
- Aussagen bleiben im Ungefähren: „Wir schauen mal“, „Vielleicht wäre es gut, wenn …“
Das Ergebnis
Mitarbeitende fühlen sich orientierungslos, vermeiden Eigenverantwortung oder handeln widersprüchlich, weil sie verunsichert sind.
Hilfreiche Formulierungen
- „Ich nehme wahr, dass …“
- „Mir ist wichtig, dass …“
- „Ich habe mich entschieden, dass …“
Reflexionsfrage
Wovor schützt mich meine Unklarheit – und wen bringt sie ins Straucheln?
Überbetonung von Prozessen: Strukturen ersetzen Beziehung
Strukturen und Prozesse geben Sicherheit. Doch wer sie zum Selbstzweck macht, verliert den Blick für das, was Menschen wirklich brauchen: gesehen, gehört und verstanden zu werden. Emotionale Abwesenheit führt oft zu einer Übersteuerung der Organisation.
Typische Zeichen
- Prozessabläufe werden rigoros verfolgt, selbst wenn sie längst nicht mehr passen.
- Zwischenmenschliche Signale bleiben unbemerkt; „Sie haben sich ja nicht gemeldet“.
- Entscheidungen werden rein formal getroffen, während echte Beteiligung ausbleibt.
- Menschliche Irritationen gelten als „Störung im System“.
Was dahintersteckt
Oft ist es ein inneres Bedürfnis nach Ordnung in einer komplexen Umgebung. Doch Ordnung ersetzt keine Beziehung.
Was hilft
- regelmäßig Raum für Zwischenmenschliches schaffen
- Prozesse als Rahmen begreifen – nicht als Ziel
- Körpersignale im Gespräch bewusst wahrnehmen
Reflexionsfrage
Dient mein Vorgehen gerade der Aufgabe oder meiner eigenen Beruhigung?
Wie zeige ich Mitarbeitenden, dass ich emotional anwesend bin?
Emotionale Präsenz zeigt sich nicht in großen Gesten, sondern in der Art, wie Gespräche geführt, Stimmungen wahrgenommen und Entscheidungen kommuniziert werden. Es geht darum, wirklich da zu sein, nicht nur körperlich, sondern auch mit Aufmerksamkeit, Klarheit und Interesse.
Fünf praktische Ansätze für emotionale Anwesenheit:
- Blickkontakt und Körpersprache bewusst einsetzen: Präsenz beginnt im Körper. Wer zuhört, sollte das auch nonverbal zeigen.
- Pausen zulassen, Raum geben: Wer sofort antwortet oder übergeht, signalisiert: Ich bin im Sendemodus.
- Fragen stellen, die mehr als Fakten berühren: „Wie geht es Ihnen gerade mit dieser Situation?“, statt „Was ist der Stand?“
- Rückmeldung einholen: „Fühlen Sie sich von mir unterstützt?“ – diese Frage braucht Mut, stärkt aber das Vertrauen.
- Sich selbst regulieren: Wer emotional aufgewühlt oder im Tunnel ist, sollte nicht führen, sondern kurz innehalten.
Was kann ich als Mitarbeitende tun, wenn meine Führungskraft emotional abwesend ist?
Nicht jede Führungskraft ist in der Lage, emotional präsent, klar und balanciert zu führen. Manchmal fehlt die Erfahrung, manchmal schlicht der Raum zur Selbstreflexion. Doch auch Mitarbeitende haben das Recht auf gute Führung.
Wer unter mangelnder Präsenz, zu viel Kontrolle oder diffuser Kommunikation leidet, kann aktiv werden. Zum Beispiel so:
Wenn emotionaler Kontakt fehlt:
„Ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit wenig über meine Themen sprechen. Wäre es möglich, dafür einen regelmäßigen Termin zu finden?“
Wenn sich die Führungskraft ständig einmischt:
„Ich würde die Aufgabe gern eigenständig bearbeiten. Gibt es Punkte, die Ihnen dabei besonders wichtig sind?“
Wenn Ansagen unklar oder widersprüchlich sind:
„Könnten Sie bitte nochmal konkret sagen, welche Lösung Sie bevorzugen? Ich bin gerade nicht ganz sicher.“
Wählen Sie eine beobachtende, konkrete und nicht vorwurfsvolle Sprache. Wenn Gespräche nicht möglich sind, kann Unterstützung durch HR, Kolleginnen und Kollegen oder externe Supervision hilfreich sein.
Fazit: Führungsfehler erkennen – Entwicklung ermöglichen
Führungsfehler sind keine Schande – sie sind unvermeidbar in komplexen Arbeitswelten. Entscheidend ist nicht, ob sie passieren, sondern ob wir sie erkennen und daraus lernen.
Emotionale Präsenz ist dabei der Schlüssel: Sie schafft Verbindung, Vertrauen und Klarheit. Sie verhindert Mikromanagement, macht Ansagen verständlich und Konflikte besprechbar.
Wer sich regelmäßig selbst hinterfragt, offen für Feedback bleibt und bereit ist, innere Haltung mit äußerem Verhalten in Einklang zu bringen, wird nicht perfekt – aber wirksam. Und genau das macht den Unterschied zwischen Führung und guter Führung.