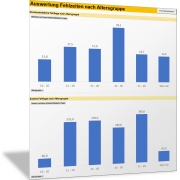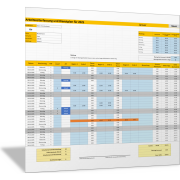ArbeitsrechtKI-Nutzung am Arbeitsplatz und was Sie arbeitsrechtlich beachten müssen
Welche Gesetze gelten für den Umgang mit KI?
Auf europäischer Ebene legt die KI-Verordnung der EU, der sogenannte AI-Act, Regeln für den Umgang mit KI-Anwendungen fest.
Auf nationaler Ebene gibt es in Deutschland bislang noch keine speziellen arbeitsrechtlichen Regelungen zur Nutzung von KI-Anwendungen. Relevant für die Frage, wie weit Arbeitgeber und Mitarbeitende bei der KI-Nutzung gehen dürfen, sind somit:
- die allgemeinen arbeitsrechtlichen Vorschriften sowie
- die Bestimmungen zum Datenschutz im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
- in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Besondere Beachtung verdient dabei das Verbot automatisierter Einzelfallentscheidungen gemäß Artikel 22 Absatz 1 DSGVO.
Sind Personalentscheidungen auf Grundlage von KI-Daten erlaubt?
Rechtliche Brisanz birgt die Frage, ob Arbeitgeber auf Grundlage von KI-Ergebnissen eine Abmahnung oder Kündigung aussprechen dürfen. Hierbei spielt das Verbot automatisierter Einzelfallentscheidungen gemäß Artikel 22 Absatz 1 DSGVO eine Rolle.
Demnach dürfen Beschäftigte keinen automatisierten Entscheidungen unterworfen werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfalten oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen.
Daraus folgt zum Beispiel, dass eine Entscheidung über eine Abmahnung oder Kündigung nicht allein auf Basis von KI getroffen werden darf, weil eine solche Entscheidung eine rechtliche Wirkung für den Arbeitnehmer entfaltet und ihn erheblich beeinträchtigt.
Auch bei Personalauswahlentscheidungen gilt: KI darf zur Unterstützung eingesetzt werden, jedoch darf die Entscheidung nicht ausschließlich auf Basis von KI-Anwendungen getroffen werden.
Somit ist es unabdingbar, dass auch eine menschliche Bewertung in den Auswahlprozess einfließt.
Dürfen Arbeitgeber den KI-Einsatz am Arbeitsplatz verbieten, einschränken oder kontrollieren?
Arbeitgeber dürfen im Rahmen ihres Weisungsrechts darüber entscheiden, ob und wie die Mitarbeiter KI am Arbeitsplatz einsetzen dürfen. Das bedeutet: Einschränkungen der KI-Nutzung durch den Arbeitgeber sind grundsätzlich erlaubt.
Arbeitgeber dürfen ihre Beschäftigten beispielsweise dazu verpflichten, die Nutzung von KI-Anwendungen am Arbeitsplatz gegenüber dem jeweiligen Vorgesetzten offenzulegen.
Unter der Voraussetzung, dass es einen sachlichen Grund dafür gibt, kann auch ein generelles Verbot der KI-Nutzung am Arbeitsplatz zulässig sein. Ein solches KI-Verbot kommt zum Beispiel bei begründeten datenschutzrechtlichen Bedenken in Betracht.
Für die Reglementierung der KI-Nutzung am Arbeitsplatz bietet es sich an, eine unternehmensinterne KI-Richtlinie zu erstellen oder erstellen zu lassen.
Inwieweit dürfen Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit KI einsetzen?
Wenn grundsätzlich eine Erlaubnis oder kein Verbot seitens des Arbeitgebers besteht, KI am Arbeitsplatz zu nutzen, stellen sich aus arbeitsrechtlicher Sicht weitere Fragen:
- Zu welchem Zweck und in welchem Umfang dürfen Arbeitnehmer bei ihrer Tätigkeit KI nutzen?
- Dürfen sie sich von KI helfen lassen, um bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen?
Hierbei ist zu beachten: Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz, dass die Arbeitsleistung höchstpersönlich zu erbringen ist. Dieses Kriterium ist wohl noch erfüllt, wenn sich ein Arbeitnehmer der KI nur zur Unterstützung bedient, aber die Tätigkeit im Wesentlichen selbst ausführt – vorausgesetzt, dass der Arbeitgeber kein generelles Verbot der KI-Nutzung im Unternehmen erteilt hat.
Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn ein Arbeitnehmer die KI für sich arbeiten lässt und KI-Ergebnisse als eigene Arbeitsleistung ausgibt. Dann ist das Erfordernis der höchstpersönlichen Erbringung der Arbeitsleistung eindeutig nicht mehr erfüllt.
In einem solchen Fall wäre eine Abmahnung durch den Arbeitgeber berechtigt. Bei wiederholten Verstößen gegen die Pflicht, die Arbeitsleistung höchstpersönlich zu erbringen, kann eine Kündigung gerechtfertigt sein.
Wer haftet für Falschauskünfte aufgrund fehlerhafter KI?
Zum Aspekt „Haftung für KI-Fehler“ gibt es bisher weder spezielle Gesetze noch eine breite Rechtsprechung. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Gerichtsurteil aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2024. Es betrifft die Haftung für Falschauskünfte wegen unzulänglicher KI-Programmierung.
Das Landgericht Kiel hat entschieden, dass jemand für Falschauskünfte haftbar gemacht werden kann, wenn er
- zur Beantwortung von Suchanfragen für Unternehmensauskünfte bewusst eine KI-Software nutzt und
- die gewonnenen Informationen auf einem Internet-Portal veröffentlicht.
Laut dem Urteil kann er sich dann nicht darauf berufen, an einem automatisierten Vorgang nicht beteiligt gewesen zu sein, wenn die KI-Software unzulänglich programmiert ist.
Dem Urteil zufolge machte sich der Anwender der KI bei Veröffentlichung der KI-generierten Informationen im Internet diese Informationen zu eigen und übernimmt nach außen hin erkennbar die inhaltliche Verantwortung für diese Inhalte.
Nach Auffassung des Landgerichts Kiel ist in einem solchen Fall ein Hinweis in den Nutzungsbedingungen des Internet-Portals, dass die Informationen in einem automatisierten Prozess gewonnen wurden und fehlerbehaftet sein können, irrelevant.
Nach Meinung des Gerichts besteht die Haftung für Falschauskünfte also auch dann, wenn in den Nutzungsbedingungen des Portals darauf hingewiesen wird, dass es sich um KI-generierte Inhalte handelt und diese möglicherweise fehlerhaft sind.
Demnach soll auch ein Haftungsausschluss für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen in einem solchen Fall unbedeutend sein.
Der AI-Act, die KI-Verordnung der EU, macht den Unternehmen strenge Vorgaben im Hinblick auf die Kontrolle, Transparenz und Dokumentation von KI-Anwendungen.
Um diese Anforderungen zu gewährleisten, empfiehlt sich die Erstellung einer betriebsinternen KI-Richtlinie. Damit können klare Regeln und eine Rechtsverbindlichkeit hergestellt werden. Wie gehen Sie vor?
Maßnahmen vor Einführung einer KI-Richtlinie
- Bestandsaufnahme durchführen
- Risikoanalyse erstellen
- Richtlinien-Entwurf erstellen
- Entwurf prüfen und gegebenenfalls anpassen
- Verbindliche Richtlinie erstellen und freigeben
Nutzen Sie die folgende Vorlage, um alle Informationen zusammenzustellen, die Sie für Ihre Regelungen zur KI-Anwendung im Unternehmen benötigen.

Was eine KI-Richtlinie beinhalten sollte
- Welche KI-Anwendungen dürfen im Unternehmen eingesetzt werden?
- Welche Daten dürfen für KI-Systeme verwendet werden und welche nicht?
- Welche organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen ergreift der Arbeitgeber?
- In welcher Form werden die Mitarbeitenden zum Umgang mit KI geschult?
- Wer ist für den technischen Support im Zusammenhang mit KI verantwortlich?
- Wer fungiert als zentraler Ansprechpartner (KI-Beauftragter) für Fragen rund um das Thema KI?
- Welche Folgen haben Verstöße gegen die Richtlinie?
Möglicher Aufbau einer KI-Richtlinie
- Ziel und Zweck der Richtlinie
- Geltungsbereich
- Definition: Was sind KI-Anwendungen?
- Ethische Aspekte
- Erlaubnisregeln hinsichtlich des Einsatzes von KI-Systemen
- Verbotsregeln hinsichtlich des Einsatzes von KI-Systemen
- Datenschutz und Datensicherheit
- Qualitätssicherung und Verantwortung
- Transparenz und Dokumentation
- Schulungsmaßnahmen
- Kontrolle des Umgangs mit KI-Anwendungen
- Folgen eines Verstoßes gegen die Richtlinie
- Datum des Inkrafttretens und Unterschriften
In der folgenden Vorlage finden Sie ein Muster, um eine eigene interne KI-Richtlinie für Ihr Unternehmen zu erstellen. Nutzen Sie die Beispielformulierungen und passen Sie diese an Ihre Gegebenheiten an. Ergänzen Sie die jeweiligen Aspekte, die für Ihr Unternehmen relevant sind.