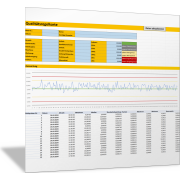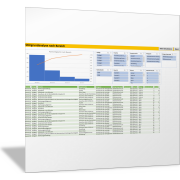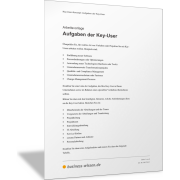Berufliche Fortbildung und WeiterbildungErfolg von Weiterbildung messen und sicherstellen
- Um welche Art von Weiterbildung geht es bei der Evaluation und Erfolgsmessung?
- Ziele der Weiterbildungsmaßnahme klären
- Unternehmensziele und Lernziele aufeinander abstimmen
- Wer hat Einfluss darauf, dass Weiterbildungsziele erreicht werden?
- Unterstützung durch Vorgesetzte sicherstellen
- Evaluationsstufen nach Donald L. Kirkpatrick
- Erfolg durch Weiterbildung messen – die richtigen Kennzahlen überprüfen
- 6 Vorlagen im Praxisteil
Um welche Art von Weiterbildung geht es bei der Evaluation und Erfolgsmessung?
Weiterbildung oder Fortbildung kann in unterschiedlicher Weise erfolgen. Meist ist damit ein formaler Rahmen gemeint, in dem Menschen etwas lernen. Je nachdem, an welchem Ort, in welchem Umfang und mit welcher Methode das Lernen stattfindet, gibt es andere Bezeichnungen.
Beispiele sind Ausbildung, (berufsbegleitendes) Studium, Abendschule, Kurs, Seminar, Training, Webinar, Online-Kurs oder auch Coaching. Sie zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie Geld kosten und dass damit ein Zeitaufwand verbunden ist. Beides betrifft die Teilnehmenden selbst – und wenn es beruflich veranlasst ist, auch das Unternehmen.
Andere Lernformen sind „informelles Lernen am Arbeitsplatz“ oder „Learning by Doing“. Sie werden im Allgemeinen nicht zur Weiter- oder Fortbildung gezählt. Deshalb werden sie im Folgenden nicht explizit in die Erfolgsbewertung einbezogen.
Ziele der Weiterbildungsmaßnahme klären
Wer Zeit und Geld für die Weiterbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert, erwartet, dass sich das rentiert. Deshalb muss bereits im Vorfeld geklärt werden: warum und wofür?
Wird eine Weiterbildungsmaßnahme geplant und ein Budget dafür bereitgestellt, kann dies aus vielen Gründen sinnvoll oder sogar notwendig sein:
- Manche Mitarbeitende erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass sie sich (regelmäßig) weiterbilden können. Eine Weiterbildungsmaßnahme dient zur Motivation, sie fördert die Mitarbeiterzufriedenheit und dient damit der Mitarbeiterbindung.
- In einigen Bundesländern (in Deutschland) haben Arbeitnehmer ein Recht auf bezahlten Bildungsurlaub.
- Mitarbeitende sollen neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen, zusätzliche Kompetenzen entwickeln. Dafür benötigen sie eine entsprechende Weiterbildung.
- Mitarbeitende sind aufgrund ihrer Arbeitssituation besonders belastet – durch außergewöhnlich hohe Arbeitsmengen, durch Konflikte mit Kolleginnen, Kollegen oder Vorgesetzten oder aufgrund ihrer privaten Situation. Eine spezielle Weiterbildung soll helfen, Aufgaben zu delegieren, Konflikte zu lösen oder mit persönlichen Problemen resilienter umzugehen.
Diese unterschiedlichen Anlässe und Gründe für Weiterbildung zeigen, dass sowohl das Unternehmen als auch der betroffene Mitarbeiter gemeinsam klären sollten, welche Ziele beide mit der jeweiligen Weiterbildung verbinden.
Über das jeweils zentrale Weiterbildungsziel stimmen sich der Mitarbeiter, seine Vorgesetzten und die Personalentwicklung gemeinsam ab. Meist erfolgt dies im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs, das vom Mitarbeiter oder von Vorgesetzten initiiert wird.
Am Ende steht fest: Der Mitarbeiter nimmt bis zum (Datum) an einer Weiterbildung teil, um (diese Ziele) zu erreichen.
Unternehmensziele und Lernziele aufeinander abstimmen
Die Anbieter einer Weiterbildungsmaßnahme und auch die Mitarbeitenden formulieren ihre Ziele meist in Form von Lernzielen. Sie erklären: Was soll der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nach der Weiterbildung wissen, können, anwenden, umsetzen, tun …?
Wenn die Ziele der Weiterbildungsmaßnahme besprochen und festgelegt werden, sollte darauf geachtet werden, dass die Unternehmensziele und die Lernziele aufeinander abgestimmt sind.
Werden die Lernziele in der Weiterbildung erreicht, sollen sie im Anschluss auch einen Beitrag dazu leisten, dass bestimmte Unternehmensziele erreicht werden. Solche Unternehmensziele können sein:
- Fehler werden vermieden
- Aufgaben werden besser erledigt
- Kunden sind mit dem Service zufriedener
- das Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen hat sich verbessert
Wie ein Lernziel und ein Unternehmensziel zur Weiterbildung formuliert sein können
Ein Mitarbeiter nimmt an einer Excel-Schulung teil, mit dem
- Lernziel: Datenanalysen mithilfe von Power Pivot durchführen können
- Unternehmensziel: Die Zahlen in den Reports sind korrekt und werden innerhalb von drei Tagen der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt.
Ob die Lern- und Unternehmensziele am Ende dann auch erreicht werden, hängt von mehreren Faktoren ab.
Wer hat Einfluss darauf, dass Weiterbildungsziele erreicht werden?
An jeder Weiterbildung wirken unterschiedliche Akteure mit. Insbesondere sind dies:
- Anbieter der Weiterbildung: Das Weiterbildungsangebot muss zu den von den Teilnehmenden verfolgten Lernzielen und zu den Unternehmenszielen passen. Damit das richtige Angebot ausgewählt werden kann, muss der Anbieter transparent darüber informieren und gegebenenfalls beraten.
- Trainerin und Trainer: Wer eine Weiterbildungsveranstaltung konzipiert, vorbereitet und durchführt, muss diese didaktisch und methodisch so gestalten, dass die Lernziele von den Teilnehmenden erreicht werden können.
- Mitarbeiter und Mitarbeiterin: Wer eine Weiterbildungsveranstaltung besucht, muss lernen wollen. Die Motivation für das Lernen muss ausreichend hoch sein. Als Teilnehmerin oder Teilnehmer muss man sich auf die Lernsituation einlassen und aktiv am Lernerfolg mitwirken. Gegebenenfalls muss man notwendige Voraussetzungen und Vorwissen bereits mitbringen.
- Vorgesetzte: Eine wichtige Aufgabe und große Verantwortung im Rahmen der Weiterbildung haben die Vorgesetzten der Teilnehmenden. Sie müssen vorab die Lernziele mit den Mitarbeitenden abstimmen und darauf achten, dass diese zu den Unternehmenszielen passen. Zudem müssen sie nach der Weiterbildung sicherstellen, dass das Gelernte in die Praxis umgesetzt, trainiert und vertieft werden kann.
Hinweis: Diese Akteure sind bei allen Formen der Weiterbildung wichtig. Bei einer reinen E-Learning-Weiterbildung übernehmen die Entwickler des Lernprogramms gewissermaßen die Rolle der Trainerin oder des Trainers – auch wenn sie an der Durchführung nicht persönlich beteiligt sind.
Unterstützung durch Vorgesetzte sicherstellen
Wie wirkungsvoll eine Weiterbildungsmaßnahme ist, zeigt sich erst im Anschluss, wenn das Gelernte in die Praxis umgesetzt wird. Damit dies möglich ist, kommt den Vorgesetzten der Teilnehmenden eine besondere Verantwortung zu.
Vorgesetzte müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an einer Weiterbildung teilgenommen haben,
- bald nach der Weiterbildung solche Aufgaben zuweisen, für die sie das Gelernte unmittelbar anwenden können,
- Zeit und Freiräume gewähren, damit das Gelernte ausprobiert, vertieft und gefestigt werden kann,
- Rückmeldung darüber geben, ob das Gelernte richtig eingesetzt wird und die erwarteten Ziele aus der Sicht des Unternehmens erreicht werden können.
Zudem sollten sie einfordern und unterstützen, dass die Teilnehmenden ihre Kolleginnen und Kollegen darüber unterrichten, was sie gelernt haben und was das Team davon hat. Gegebenenfalls können sie Gelerntes an andere im Team weitergeben.
Auch dies kann den Lernerfolg steigern: Wenn Lernende anderen das Gelernte erklären, ist dies meist besonders förderlich, um das Wissen, Können und Verhalten zu festigen und zu vertiefen.
Wichtig ist, dass all dies möglichst bald, wenige Tage nach der Weiterbildung erfolgen kann – bevor die Mitarbeitenden das Gelernte wieder vergessen haben. Zudem fördert besonders das wiederholende Üben den Lernprozess.
So fordern Sie die Umsetzung des Gelernten ein
Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an einer Weiterbildungsveranstaltung teilnimmt oder teilnehmen will, fordern Sie als Vorgesetzte:
„Bringe aus deiner Weiterbildung drei Dinge mit, die du, unser Team oder das Unternehmen umsetzen oder tun sollten, damit wir uns verbessern. Unabhängig wie klein oder groß die Maßnahme ist – also auch kleine Verbesserungsvorschläge zählen.“
Fragen Sie die mitgebrachten Vorschläge und Maßnahmen nach der Weiterbildung ab und fordern Sie die Umsetzung ein.
Evaluationsstufen nach Donald L. Kirkpatrick
Um den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen zu messen und zu beschreiben, orientieren sich viele Personaler an den vier Evaluationsstufen, die der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Donald L. Kirkpatrick in den 1950er-Jahren entwickelt hat.
Demnach soll der Erfolg der Weiterbildung betrachtet und gemessen werden auf:
Stufe 1: Zufriedenheit der Teilnehmenden
Die Teilnehmenden selbst müssen mit der Weiterbildung zufrieden sein. Das ergibt sich aus ihren Erwartungen und Zielen, die sie zur Veranstaltung mitgebracht haben und dem dort Erlebten. Das betrifft die
- Lerninhalte,
- Art der Vermittlung durch Trainierende,
- anderen Teilnehmenden und die Beziehungen untereinander,
- Örtlichkeit und
- Organisation rund um die Weiterbildungsveranstaltung.
Stufe 2: Kompetenzerweiterung
Die Teilnehmenden müssen bei einer erfolgreichen Weiterbildungsveranstaltung – vereinfacht gesagt – mit mehr Wissen, Können, Fähigkeiten oder Fertigkeiten herauskommen, als sie hineingegangen sind. Das kann auch das Erfahrungswissen betreffen, wenn sie sich mit Trainierenden und anderen Teilnehmenden ausgetauscht haben.
Sie müssen also ihre Kompetenzen in Bezug auf die Lernziele und ihre vorherigen Kompetenzen erweitert haben.
Stufe 3: Verhaltensänderung
Was die Teilnehmenden aus der Weiterbildungsveranstaltung mitgenommen haben, das sollten sie im Unternehmen auch anwenden. Das hat drei Aspekte:
- Sie können es anwenden, weil sie die Inhalte der Weiterbildung verstanden und geübt haben.
- Sie dürfen es anwenden, weil Vorgesetzte sie mit entsprechenden Aufgaben betrauen und ihnen Gelegenheiten geben, die erworbenen Kompetenzen auszuprobieren, zu trainieren und zu vertiefen.
- Sie wollen die neuen Kompetenzen anwenden, weil sie das Gelernte als sinnvoll und hilfreich erlebt haben und weil sie es sich zutrauen – und keine Furcht vor Fehlern haben; die Teilnehmenden sind von ihrer Selbstwirksamkeit durch die Weiterbildung überzeugt.
Stufe 4: Effekte für das Unternehmen
Eine Weiterbildung für Mitarbeitende soll letztlich dazu beitragen, dass die Unternehmensziele (besser) erreicht werden. Welche das im Einzelnen sind, sollte im Vorfeld festgelegt und besprochen werden. Das kann beispielsweise betreffen:
- Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigt,
- Kundenservice wird besser,
- Fehlerrate sinkt,
- neue Technologien werden beherrscht, was die Wettbewerbsfähigkeit verbessert,
- Produktivität steigt durch weniger Zeitaufwand für gleiche Ergebnisse,
- Flexibilität des Unternehmens wird größer, weil Mitarbeitende vielfältige Aufgaben übernehmen können,
- Veränderungsbereitschaft steigt, sodass die Organisation schneller auf andere Rahmenbedingungen reagieren kann,
- Betriebsklima verbessert sich und die Fluktuation sinkt, weil der Umgang der Mitarbeitenden untereinander besser ist.
Erfolg durch Weiterbildung messen – die richtigen Kennzahlen überprüfen
Für jede Evaluationsstufe lassen sich Kennzahlen festlegen, mit denen gemessen oder ausgedrückt werden kann, was im Einzelnen durch eine Weiterbildung erreicht wurde.
Stufe 1: Teilnehmende befragen
Mitarbeitende werden nach der Weiterbildung befragt, wie zufrieden sie waren. Dazu werden Fragen gestellt wie:
- Haben Sie Ihre Lernziele erreicht?
- Haben Sie etwas für sich Nützliches gelernt?
- Haben Sie aus Ihrer Sicht Ihre Kompetenzen verbessert?
- Passt das Gelernte zu Ihren aktuellen oder zukünftigen Aufgaben, sodass Sie diese besser erledigen können?
Die Antworten werden meist auf einer Likert-Skala oder durch eine Note gegeben. Zum Beispiel in der Form „ja, vollständig erreicht“ oder Note „sehr gut“ bis zu „nein, gar nichts erreicht“ oder Note „ungenügend“.
Stufe 2: Tests durchführen
Während oder nach einer Weiterbildung kann der Kompetenzerwerb der Teilnehmenden durch Tests überprüft werden. Genaugenommen müsste das Testergebnis vor der Maßnahme mit dem Ergebnis nach der Maßnahme verglichen werden.
Welche Art der Tests durchgeführt werden kann, hängt von der Art der Weiterbildung und den Lernzielen ab:
- Wissen kann abgefragt oder durch Aufgaben, praktische Übungen oder Rollenspiele überprüft werden,
- Fähigkeiten und Fertigkeiten können durch Probearbeiten geprüft werden.
Wichtig ist, dass die Tests so konzipiert sind, dass damit die Kompetenzen gemessen werden, die durch die Weiterbildung erworben oder verbessert werden sollten. Das setzt Know-how der Testenden für die Testgestaltung voraus.
Stufe 3: Vorgesetzte und andere Personen aus dem Arbeitsumfeld befragen
Inwieweit die Teilnehmenden einer Weiterbildung ihre Kompetenzen dann auch am Arbeitsplatz einsetzen, müssen insbesondere die Vorgesetzten beurteilen. Sie geben Feedback darüber, ob sich die Leistung oder das Verhalten im gewünschten Sinn verändert hat.
Dazu können etwa vier bis sechs Wochen nach der Weiterbildung Mitarbeiter- oder Feedbackgespräche durchgeführt werden. Die Vorgesetzten besprechen die Leistungen mit den Mitarbeitenden und bewerten diese – je nachdem, um welche Art von Aufgaben und Leistung es geht.
Darüber hinaus können auch Kolleginnen und Kollegen oder Kunden befragt werden, ob sich das Verhalten und die Leistung der betreffenden Person verändert und verbessert haben. Auch sie können dazu eine qualitative Beschreibung oder eine Bewertung abgeben.
Stufe 4: Unternehmens- und Teamziele überprüfen
Inwieweit die Kompetenzerweiterung und die Leistungs- und Verhaltensänderungen einer einzelnen Person zu den Unternehmenszielen beitragen, lässt sich meist nur sehr schwer messen. Zudem hängt es von der Art der Aufgaben, der benötigten Kompetenz und den Unternehmenszielen und Zielvereinbarungen ab.
Beispiele für mögliche messbare Effekte sind:
- Die Fehlerrate nimmt nach der Weiterbildung ab, sodass das Unternehmen Zeit und Kosten sparen kann oder die Kunden zufrieden(er) sind.
- Die Reklamationsquote sinkt, weil die Kunden nach der Weiterbildung besser und kompetenter beraten werden.
- Mehr Kundenanfragen werden auf dem Service-Level 1 erledigt, was das Unternehmen Zeit und Geld spart.
- Aufgrund von erworbenem Technologie-Know-how kann ein neues Produkt früher auf den Markt gebracht werden.
- Die Krankenquote und die Fluktuationsrate unter den Beschäftigten sinken, weil sich das Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitenden untereinander nach einer Weiterbildung verändert hat.
- Mitarbeitende erledigen nach der Weiterbildung ihre Aufgaben schneller, weil sie ihr neues Wissen anwenden oder besser organisiert sind. Die Produktivität des Teams steigt.
- Mehr Projekte werden „in time“ und „in budget“ erledigt, weil die Projektleitungen neu erworbene Kompetenzen im Projektmanagement einsetzen.
Beachten Sie dabei auch: Viele betriebswirtschaftliche Effekte von Weiterbildung zeigen sich erst im Laufe der Zeit. Das neue Wissen muss erprobt, vertieft und mehrfach angewendet werden, bevor es wirklich einen (messbaren oder erkennbaren) Beitrag zu den Unternehmenszielen leisten kann.
In der Bildungsforschung wurden eine Reihe von Methoden und Messwerkzeugen (Fragebögen) entwickelt, um die Effekte von Weiterbildung messen zu können. Zum Beispiel: Das deutsche Lerntransfer-System-Inventar (GLTSI), Münsteraner Fragebogen zur Evaluation von Seminaren – revidiert (MFE-Sr) oder Fragebogen zur professionellen Trainingsevaluation (Q4TE).
Weiterbildung sorgfältig planen und vorbereiten
Klären Sie, wie Sie die Effekte und den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen in Ihrem Unternehmen sicherstellen und bewerten wollen.
Sorgen Sie dafür, dass alle Maßnahmen zur Weiterbildung sorgfältig geplant und vorbereitet sind. Dazu zählen insbesondere:
- Der Weiterbildungsbedarf wurde zwischen Mitarbeitenden und ihren Vorgesetzten abgestimmt.
- Es wurden gemeinsam Lernziele und Unternehmensziele formuliert, die mit der Weiterbildung erreicht werden sollen.
- Das Umfeld ist geeignet, dass die Teilnehmenden an einer Weiterbildung das Gelernte im Anschluss im Unternehmen anwenden können.
- Die Vorgesetzten fordern und unterstützen die Anwendung des Gelernten.
Nur dann lassen sich positive Effekte erzielen. Dokumentieren Sie dazu, welche Abstimmungen im Vorfeld der Weiterbildung erfolgt sind.
Nutzen Sie dazu die folgende Vorlage.
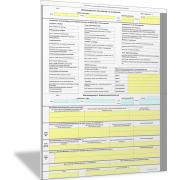
Beachten Sie außerdem: Weiterbildung ist ein Teil der Personalentwicklung und sollte mit anderen Maßnahmen zur Personalentwicklung abgestimmt werden.
Weiterbildungserfolg messen
Klären Sie, welche Methoden und Werkzeuge für die jeweilige Weiterbildung geeignet sind. Orientieren Sie sich dazu am Stufenmodell von Kirkpatrick.
Bereiten Sie entsprechend für die Erfolgsmessung vor:
- Feedback- und Kritik-Formulare für Teilnehmende an Weiterbildungsveranstaltungen
- Analyse der Rückmeldungen zur Weiterbildung
- Auswertung von weiteren Daten zu den Kompetenzen der Mitarbeitenden; zum Beispiel Protokolle aus Mitarbeitergesprächen
- Formulare und Protokollvorlagen, mit denen Vorgesetzte nach der Weiterbildung mit den Mitarbeitenden besprechen, wie das Gelernte umgesetzt wird
- Kennzahlen wie Fluktuationsrate, Leistungs- und Verkaufsstatistiken
Personalentwicklungsmaßnahme beurteilen
Legen Sie den folgenden Fragebogen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, die an einer Personalentwicklungsmaßnahme teilgenommen haben. Sammeln Sie alle Ergebnisse und bewerten Sie so die jeweilige Personalentwicklungsmaßnahme.

Eine ausführlichere Variante für die Evaluation der Bildungsmaßnahme ist die folgende Vorlage.

Bewertung der Weiterbildung im Mitarbeitergespräch
Prüfen Sie anhand der vor der Weiterbildung getroffenen Vereinbarungen, inwiefern diese erreicht wurden. Werten Sie dazu das Formblatt zum Mitarbeitergespräch zur Personalentwicklung aus.
Ergänzend dazu sollten die Vorgesetzten mit den Mitarbeitenden den folgenden Bewertungsbogen besprechen.

Zudem können die Vorgesetzten dieses Bewertungsformular nutzen.
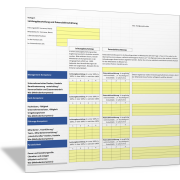
Weitere Kennzahlen auswerten zur Wirtschaftlichkeit von Weiterbildung im Unternehmen
Um die Wirtschaftlichkeit von Weiterbildungsmaßnahmen zu beurteilen, können weitere Kennzahlen ausgewertet werden. Zum Beispiel:
- Anzahl der jährlichen Weiterbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter und pro Führungskraft
- Kosten der jährlichen Weiterbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter und pro Führungskraft
- Anteil der bedarfsorientiert konzipierten Weiterbildungsmaßnahmen
- Anteil firmenspezifischer oder standardisierter Weiterbildungsmaßnahmen
- Weiterbildungskosten pro Tag und Teilnehmenden
- Anteil aktiver und passiver Lehrmethoden in der Weiterbildung; Präsenzveranstaltungen und E-Learning-Angebote
- Anzahl an Follow-up-Veranstaltungen zur Transfersicherung
- Ergebnisse der Feedback-Bewertung von Weiterbildungsveranstaltungen durch die Teilnehmenden
- Anzahl der Beteiligungen am betrieblichen Vorschlagswesen
So verschaffen Sie sich ein Bild, inwiefern Weiterbildungsmaßnahmen insgesamt zu den Unternehmenszielen und zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen.
Evaluationskonzept erstellen
Fördern Sie die Lernkultur in Ihrem Unternehmen, indem Sie jede umfangreiche Weiterbildungsmaßnahme und ihre Effekte und Erfolge auswerten. Erstellen Sie dazu ein Evaluationskonzept.
Darin beschreiben Sie für die Personalentwicklung, die Fachabteilungen, die Vorgesetzten und Mitarbeitenden, warum und wie Weiterbildungsmaßnahmen zu planen und zu bewerten sind.
Die folgende Vorlage dient Ihnen als Muster für ein entsprechendes Evaluationskonzept.